
Mit den neuen Anpassungen der Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 2023 und den Änderungen im Forschungszulagengesetz (FZulG) – auch bekannt als Wachstumsbooster– rückt der Gemeinkostenzuschlag in den Mittelpunkt für viele Unternehmen, insbesondere für kleine und mittelständische Förderempfänger.
Die Änderungen betreffen zwei zentrale Förderzweige:
Dank der aktualisierten Regelungen eröffnen sich erweiterte Fördermöglichkeiten und deutlich attraktivere Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Veränderungen beim Gemeinkostenzuschlag wichtig sind, welche Chancen sich daraus für Ihr Unternehmen ergeben und wie Sie sich schon jetzt strategisch optimal auf die kommenden Neuerungen vorbereiten können.
Bis Ende 2023 konnten Unternehmen laufende Kosten wie Miete, Verwaltung oder Energiekosten noch großzügig pauschal ansetzen – je nach Förderprogramm mit einem Zuschlag von bis zu 120 % auf die Personalkosten. Mit der AGVO-Novelle 2023 hat sich das jedoch grundlegend verändert: Ab sofort ist nur noch ein Gemeinkostenzuschlag von maximal 20 % zulässig. Die gute Nachricht: Ab dem 1. Januar 2026 gilt diese 20 %-Pauschale auch für Projekte, die nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) gefördert werden.
Für Unternehmen bedeutet das: Wer bisher stark von den hohen Pauschalen profitiert hat, sollte jetzt aktiv handeln. Eine sorgfältige Analyse der Kostenstruktur und eine smarte Förderstrategie sind entscheidend, um trotz des reduzierten Gemeinkostenzuschlags weiterhin optimale Förderchancen zu sichern und finanzielle Nachteile zu vermeiden.
Einheitlicher Gemeinkostenzuschlag von max. 20 % – auch für FZulG. Jetzt Kostenstruktur prüfen und Strategie anpassen.
Seit 2024 sind Einzelnachweise für Gemeinkosten Pflicht – Förderprogramme wie ZIM und BMFTR akzeptieren keine Pauschalen mehr. Frühzeitige Prozessanpassung sichert Förderchancen.
Gemeinkosten sauber dokumentieren, nicht förderfähige Posten beachten und Gestaltungsspielräume wie Bruttolohnmodell nutzen.
Indirekte Kosten optimal erfassen, steuerliche Vorteile sichern und Fördermittel voll ausschöpfen.
Pauschale Schätzungen entfallen – neue Standards für Buchhaltung und Controlling sind Pflicht.
Der Gemeinkostenzuschlag für KMU muss seit 2024 individuell und unternehmensspezifisch berechnet werden. Das Zentrale Innovationsprogramm ZIM sowie die Förderprogramme des BMFTR (ehemals: BMBF) wurden bereits umgestellt: Neue Bewilligungen mit der alten Pauschale werden nicht mehr erteilt. Stattdessen sind verpflichtende Einzelnachweise vorgesehen. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: mehr bürokratischer Aufwand, höhere Anforderungen – und neue Risiken. Wer sich jedoch frühzeitig informiert und seine Prozesse gezielt anpasst, sichert sich weiterhin wertvolle Förderchancen und vermeidet teure Stolperfallen.

Die Reform des Gemeinkostenzuschlags bringt eine stärkere Ausrichtung auf das Selbstkostenprinzip mit sich. Unternehmen müssen künftig ihre Gemeinkosten nicht mehr pauschal, sondern auf Basis tatsächlicher Aufwendungen nachweisen. Das bedeutet:
Gerade kleine und mittlere Unternehmen stehen aktuell vor der anspruchsvollen Aufgabe, ihre Gemeinkosten nicht nur transparent, sondern auch prüfungssicher darzustellen. Die Anforderungen an die Dokumentation steigen deutlich: Förderfähige Kosten müssen über verschiedene Kostenstellen und Tätigkeitsbereiche hinweg exakt erfasst und zugeordnet werden. Besonders herausfordernd ist dies bei “Sammelposten”, in denen förderfähige und nicht-förderfähige Kostenpositionen gemeinsam erfasst werden – etwa bei Firmenfahrzeugen oder Softwarelizenzen.
Gleichzeitig wird die Finanzierungsplanung komplexer, da Förderquoten sinken und Eigenanteile steigen können, wenn bestimmte Kostenpositionen wie Vertriebskosten oder Tantiemen nicht korrekt identifiziert und berücksichtigt werden. Doch die Reform bietet auch Chancen: Wer die Gestaltungsspielräume gezielt nutzt – etwa durch die Wahl zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbrutto oder die Berücksichtigung von Abschreibungen auf Maschinen – kann unter Umständen sogar höhere förderfähige Beträge erzielen. Voraussetzung dafür ist jedoch eine sorgfältige Analyse und eine strategische Anpassung der internen Prozesse.
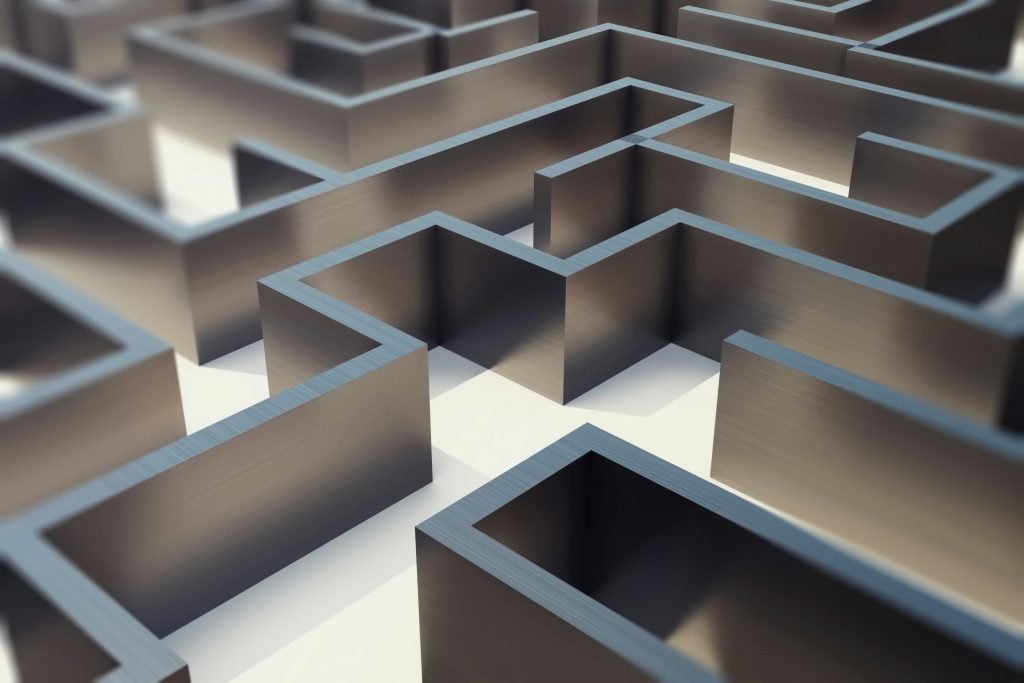
Der Gemeinkostenzuschlag ist ein zentrales Instrument zur Abbildung indirekter Projektkosten. Er entscheidet darüber, ob Kosten wie Miete, Verwaltung oder IT in Förderprojekten berücksichtigt werden können. Besonders relevant ist dies für:
Für Unternehmen eröffnet sich dadurch eine große Chance: Mit der richtigen Anpassung von Kostenstrukturen können sie die Fördermittel maximal ausschöpfen und ihre Innovationsprojekte zukunftssicher finanzieren. Der Aufwand zur Bewertung und Optimierung der Gemeinkostenberechnung lohnt sich also.
Die neue Regelung zum Gemeinkostenzuschlag verlangt von Unternehmen eine präzise und projektbezogene Erfassung ihrer Gemeinkosten. Pauschale Schätzungen gehören der Vergangenheit an – stattdessen müssen Aufwendungen wie Strom, Miete oder Versicherungen anteilig und nachvollziehbar dem jeweiligen Projekt zugeordnet werden. Im Zentrum steht das Selbstkostenprinzip: Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Basis tatsächlicher Kosten, nicht auf Grundlage von Marktpreisen oder pauschalen Erfahrungswerten. Diese Umstellung erfordert ein hohes Maß an Disziplin in der Buchhaltung, denn förderfähige und nicht förderfähige Posten – etwa Vertriebskosten, Rechtsstreitigkeiten oder kalkulatorischer Gewinn – müssen klar voneinander abgegrenzt und dokumentiert werden. Nur so lässt sich die Förderfähigkeit sicherstellen und eine prüfungssichere Projektabrechnung gewährleisten.
PFIF hat als Fördermittelpartner bereits unzählige KMU begleitet und führt Unternehmen auch beim geänderten Gemeinkostenzuschlag sicher durch die Neuerungen.
Unsere Leistungen: Wir prüfen die Förderfähigkeit Ihrer Vorhaben, berechnen die anrechenbaren Gemeinkosten nach aktuellen Vorgaben und übernehmen sowohl die Antragstellung als auch die Erstellung des Verwendungsnachweises. PFIF unterstützt Sie dabei in etablierten Förderprogrammen wie ZIM, BMFTR oder KMU-innovativ ebenso wie bei der steuerlichen Forschungszulage (FZulG). So stellen wir sicher, dass Ihre Prozesse förderfähig, effizient und prüfungssicher gestaltet sind – individuell, persönlich und digital.
